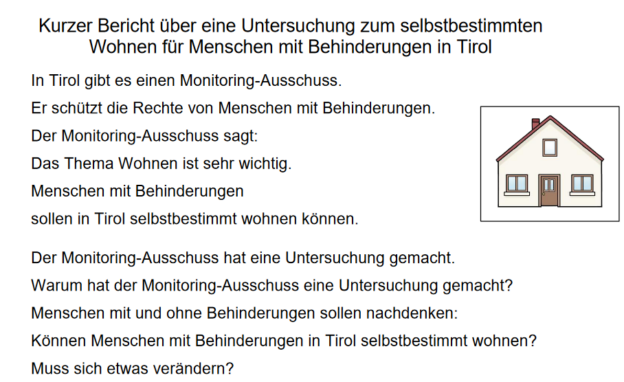Von Laura Nadine Hochsteiner
Fremdbestimmung und Paternalismus prägten und prägen auch heute noch das Leben von Menschen mit Behinderungen (vgl. Couser 2005; 2017). Beispielsweise im medizinischen Bereich wird häufig auf Basis rückständigen Denkens und menschenverachtender Vorstellungen darüber verfügt, welches Leben als „wertvoll“ und „lebenswert“ zu erachten sei (vgl. United Nations, Department of Economic and Social Affairs). Das medizinische Setting ist nur als einer von vielen Bereichen anzuführen, in denen Menschen mit Behinderungen ihrer Stimme beraubt wurden bzw. werden. Doch Bevormundung, Diskriminierung und Ausgrenzung wurden und werden nicht einfach hingenommen und erduldet.
Analyse einer First-Person-Geschichte
In den letzten Jahren hat die Beschreibung der eigenen Erfahrungs- und Erlebniswelt in Form von autobiographischen Darstellungen dazu beigetragen, dass Menschen mit Behinderungen vermehrt Gehör finden und öffentlich inhumane, menschenunwürdige Narrative anprangern können (Couser 2005:603f.; Smith und Watson 2010:141–145). Diese „Life Narratives“ – wie sie in der Literaturwissenschaft genannt werden – dienen oftmals aktivistischen Bestrebungen (vgl. Smith/Watson 2010:142). Auch Alice Wong, die US-amerikanische Behindertenrechtsaktivistin und Herausgeberin des Sammelbandes Disability Visibility (2020), versucht mit ihren Memoiren, welche mit dem Titel Year of the Tiger (2022) versehen wurden, Aufklärungsarbeit (in den USA) zu betreiben und so die Situation von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Wongs Werk wird im Zuge der Masterarbeit, die den Arbeitstitel „‚The World Will Finally See Us as We Are‘—Dis/ability and Life Writing: Taking Control of the Narrative in Alice Wong’s Year of the Tiger (2022)“ trägt, untersucht.
Die Qualifikationsschrift, welche dem Fach American Studies zuzuordnen ist, ergründet folgende Forschungsfragen: Wie wird Wongs eigene Erfahrung als Mensch mit Behinderungen und ihr persönliches Erleben von Ableismus im gegenwärtigen US-amerikanischen Kontext in ihrem Werk dargestellt? Wie wird die Vorstellung eines „lebenswerten Lebens“ in ihrem Text hinterfragt? Auf welche Art und Weise wird Intersektionalität, insbesondere im Hinblick auf „gender“ und „race/ethnicity“, in Verbindung mit Behinderung in Year of the Tiger beschrieben? Zur Beantwortung dieser Forschungsfragen wird das gewählte Werk mithilfe theoretischer Grundlagen und konzeptueller Werkzeuge der Critical Disability Studies und der Life Writing Studies einem Close Reading unterzogen.
Begründung des Forschungsvorhabens
Ziel der Arbeit ist es, zu verdeutlichen, dass Behinderung in Wongs Memoiren als eine alternative Lebensweise verstanden wird, welche einzigartige und wertvolle Erkenntnisse zum menschlichen Dasein liefert. Auch soll gezeigt werden, dass Wongs Lebensgeschichte als aktivistisches Instrument gebraucht wird.
Die Relevanz dieses Forschungsvorhabens liegt in seinem Potenzial begründet, auf Erfahrungen von Behinderung und Ableismus in der heutigen Zeit aufmerksam zu machen und so zur Bewusstseinsbildung und Aufklärung beizutragen. Zuzüglich soll mit dieser Arbeit ein (bescheidener) Beitrag dazu geleistet werden, die Disability Studies in Österreich vermehrt in der (US-amerikanischen) Literaturwissenschaft zu verankern, was wiederum die „Profilierung der Disability Studies als eigenständiges Fach“ erleichtern soll (Köbsell 2020:67).
Laura Nadine Hochsteiner absolvierte die Bachelorstudien Anglistik/Amerikanistik (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) und Transkulturelle Kommunikation (Karl-Franzens-Universität Graz). Aktuell belegt sie die Masterstudien Konferenzdolmetschen (Karl-Franzens-Universität) und Joint Degree in English/American Studies (Karl-Franzens-Universität Graz und Università Ca‘ Foscari Venezia).
Couser, G. Thomas (1997) Recovering Bodies. Illness, Disability, and Life Writing. Madison: The University of Wisconsin Press.
Couser, G. Thomas (2005) „Disability, Life Narrative, and Representation“, in: PMLA 120:2, 602–606.
Couser, G. Thomas (52017) „Disability, Life Narrative, and Representation“, in: Davis, Lennard J. (ed.) The Disability Studies Reader. New York/London: Routledge, 450–453.
Köbsell, Swantje (2022) „Entstehung und Varianten der deutschsprachigen Disability Studies“, in: Waldschmidt, Anne (ed.) Handbuch Disability Studies. Wiesbaden: Springer VS, 55–71.
Smith, Sidonie/Watson, Julia (22010) Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs [o.J.] „Five Things You Need to Know about Living with a Disability during COVID-19“, in: https://www.un.org/en/desa/five-things-you-need-know-about-living-disability-during-covid-19 [31.10.2023].
Wong, Alice (2022) Year of the Tiger. An Activist’s Life. New York: Vintage Books.
Wong, Alice (ed.) (2020) Disability Visibility. First-Person Stories from the Twenty-First Century. New York: Vintage Books.