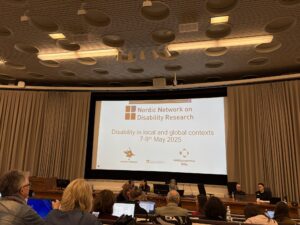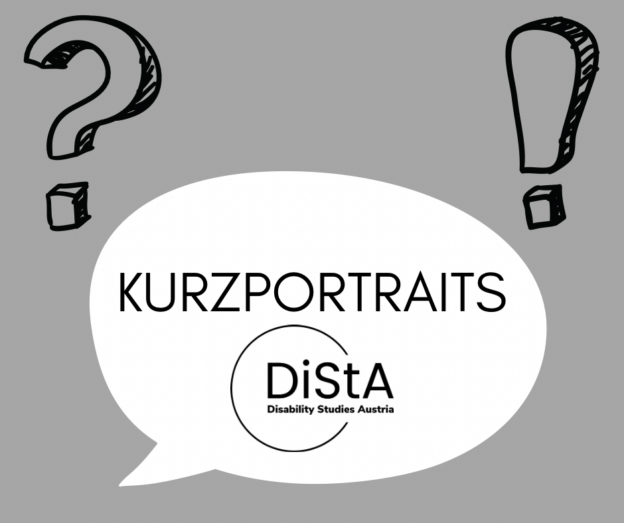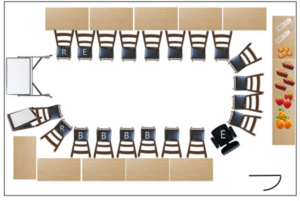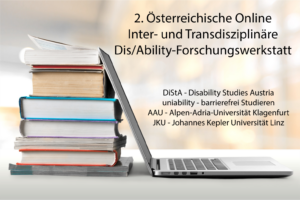Am 23. Mai 2025 fand die 4. Österreichische Inter- und Transdisziplinäre Dis/Ability-Forschungswerkstatt statt. Diesmal war sie wieder vollständig online. Es nahmen 27 Personen teil, darunter Studierende, Wissenschaftler-innen sowie Personen aus der Praxis. Die Forschungswerkstatt wurde von Laura Hochsteiner, Andreas Jeitler, Michaela Joch, Rahel More und Angela Wegscheider organisiert.
In diesem Jahr wurde der Workshop-Charakter durch längere Slots stärker betont. Innerhalb von 15-20 Minuten wurde ein Beitrag vorgestellt und anschließend von der jeweiligen Workshop-Moderatorin und den Anwesenden vertiefend diskutiert. Ziel war die Förderung einer konstruktiven Feedbackkultur sowie der Austausch zwischen den Teilnehmenden.
Behinderung und Armut in österreichischen Haushalten
Nach der Begrüßung durch Rahel More, moderierte Laura Hochsteiner den ersten Beitrag. Carmen Walenta-Bergmann und Angela Wegscheider (JKU Linz) stellten ihr Forschungsprojekt zu Behinderung und Armut in österreichischen Haushalten vor. Sie untersuchten unter Auswertung von EU-SILC Daten das Risiko von Einkommensarmut bei Haushalten mit behinderten Mitgliedern in Österreich. Dabei stellten sie fest, dass dieses Risiko nicht vollständig durch die typischen sozioökonomischen Merkmale erklärt werden kann, sondern, dass es eine unerklärte Armutsgefährdungslücke gibt. Sie warfen die Frage auf, ob Behinderung an sich ein Faktor ist und ob der österreichische Wohlfahrtsstaat ableistisch ist. Es folgten vor allem Fragen zur Datenauswertung und Anregungen, u.a. zur Einbeziehung von Gender, Care Arbeit oder die inhaltliche Ergänzung durch qualitative Erhebungen.
Projekt zu (sexualisierter) Gewalt im sozialen Nahraum an Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in Südtirol
Im zweiten Slot, der von Rahel More moderiert wurde, stellte Julia Ganterer (Uni IBK) ihre Arbeit zur Gewaltforschung und ihr geplantes Projekt zu (sexualisierter) Gewalt im sozialen Nahraum an Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in Südtirol vor. Das partizipativ angelegte Projekt soll den Fokus auf die Entstehungsbedingungen, Kulturen des Schweigens und Meldehemmnisse im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen im sozialen Umfeld legen. Ein wichtiges Ziel der Studie soll sein, mit diesen Erkenntnissen präventive Maßnahmen inklusiv gestalten zu können. Die Diskussion war rege, da einige Anwesende zu ähnlichen Themen arbeiten. Es wurden u.a. Erfahrungen eingebracht, wie die Erhebung inklusiv gestaltet und body mapping als Methode verwendet werden könnte. Darüber hinaus wurde die Wichtigkeit positiver Zugänge zu Sexualität, das Einbeziehen von Fachpersonal von GSE und (Selbstvertretungs-)vereinen, sowie die Berücksichtigung (mangelnder) Zugänglichkeit von sexueller Bildung neben Täter*innenrollen betont.
Nutzung von Assistierenden Technologien im Alltag von Menschen mit Behinderungen
Nach der Mittagspause moderierte Michaela Joch den dritten Slot zur Nutzung von Assistierenden Technologien im Alltag von Menschen mit Behinderungen. Anna Ajlani (JKU Linz) stellte ihr Dissertationsprojekt vor, das im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojekt Assistive Technologies Lab (ATLab) verfasst wird. Im Mittelpunkt stehen dabei die Erfahrungen von Menschen mit Print Disabilities, welche einen stark textbasierten Kommunikationsstandard über alle gesellschaftlichen Bereiche hinweg navigieren müssen. Print Disabilities meint dabei ein breites Verständnis von Lese- und Sehbehinderungen, darunter z.B. Blindheit, Dyslexie, aber u.a. auch kognitive Beeinträchtigungen oder eine eingeschränkte Handfunktion. Sie erforscht wie Menschen mit Print Disabilities assistierende Technologien im Alltag kreativ modifizieren und zweckentfremden, um ihre Teilhabe in Bildung, Arbeit und Freizeit trotz mangelnder Zugänglichkeit zu verbessern. Methodisch greift sie auf qualitative Interviews und ethnografische Beobachtungen zurück (u.a die Methode der Story Completion). Es folgte eine rege Diskussion zur Offenlegung von Behinderungen und zur Theorie Crip Spacetime. Es wurde darüber hinaus gemeinsam überlegt, wie man eine diverse Gruppe von Menschen mit Print Disabilities am besten erreichen kann.
Vernetzungsaufruf zu Disability History in Museen
Im letzten Slot, der von Angela Wegscheider moderiert wurde, stellte Jennie Carvill Schellenbacher die Arbeit des Hauses der Geschichte Österreichs und des Wien Museums zu Disability History und die Arbeit in Bezug zu Barrierefreiheit vor. Das zentrale Anliegen ihres Beitrages ist die Vernetzung zu Disability History in Museen. Sie und Vanessa Tautter wollen eine Arbeitsgruppe gründen, die sich mit der Geschichte von Behinderung in musealen Kontexten beschäftigt, um Austausch, Best Practices und Sichtbarkeit von Disability History in Museen zu fördern. Wichtige Beiträge zu inhaltlicher Barrierefreiheit, Storytelling, institutioneller Verankerung folgten, abgerundet durch weitere Beispiele aus der Museumsarbeit. Das erste online Arbeitsgruppentreffen zu Disability History in Museen ist für 16.06.2025 um 16h geplant. Für den Zugangslink, bitte um Anmeldung bei jennie.schellenbacher@wienmuseum.at.
Den Abschluss der Forschungswerkstatt bildete ein Überblick über die Arbeit von DiStA und die Einladung zur aktiven Mitarbeit. Disability Studies Austria – DiStA – ist eine Arbeitsgruppe und Koordinationsplattform von Menschen, die im Sinne der Disability Studies forschen und arbeiten. Das nächste Treffen findet im Zuge der ALTER Conference am 8. Juli um 10:30h im Agnes-Heller-Haus, Innrain 52a Innsbruck und auch hybrid statt. Bitte um Anmeldung für den Zugangslink bei angela.wegscheider@jku.at
Wir danken allen Teilnehmenden und Vortragenden für ihre Beiträge und die gemeinsame Veranstaltung! In den kommenden Wochen werden auf dem DiStA-Blog einige der Vortragenden ihre Beiträge veröffentlichen.