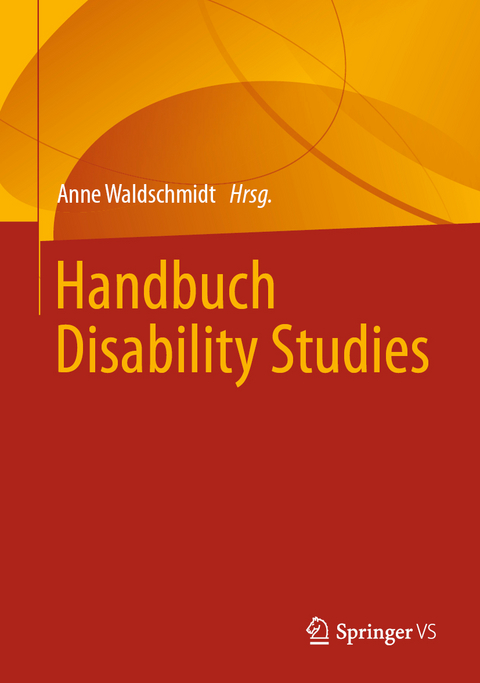Nun öffnet wieder alles und Covid geht zurück, zwar noch nicht in der Bevölkerung, aber zumindest in der Medienberichterstattung bzw. wird es durch andere wichtige Ereignisse verdrängt. Dabei sind es nun schon mehr als zwei Jahre in denen wir alle mit der Covid-19 Pandemie, ihren Auswirkungen und den Folgen der dagegen ergriffenen Maßnahmen konfrontiert sind. Wie auch bei anderen gesellschaftlichen Problemzonen sind viele Menschen mit Behinderungen oft ganz besonders betroffen. Das reicht von Vereinsamung während der Lockdowns in Pflegeheimen, Ärger über Mitmenschen, die die Schutzbestimmungen nicht einhalten und somit besonders gefährdete Menschen unnötig weiter in Gefahr bringen oder in die Isolation treiben, Problemen mit persönlichen Assistent*innen oder Pfleger*innen, die als Ansteckungsrisiko dienen oder krankheitsbedingt ausfallen, Ängsten vor Abwertungen in drohenden Triagen bis zu Diskursen über totale Öffnungen und die „Rechte der Gesunden“.
Im Folgenden werden ausschnitthaft Links zu interessanten Zeitungsbeiträgen und wissenschaftlichen Artikeln zum Thema vorgestellt.
 |
 |
| Quelle: Pixabay, María_Alberto |
Quelle: Pixabay, TheDigitalArtist |
Zeitungsartikel und Onlinebeiträge
Ein Artikel vom 6.03.2022 aus New Haven Register geht auf diverse Barrieren für Menschen mit Behinderungen aufgrund der Covid-Politik im US-Kontext ein. –„We have been ignored, forgotten, and left out of policy discussions” – ‘People were okay with leaving us behind’: COVID harder on those with disabilities, experts say
Ein weiterer Artikel aus dem Guardian wurde vom 03.02.2022 von George Taleporos der Chairperson des Victorian Disability Advisory Council verfasst und kritisiert die australische Covid-Strategie in Bezug auf Menschen mit Behinderungen – “Federal and state governments have failed disabled people like me during the pandemic” – As a disabled person trying to ‘live with’ Covid in Australia, every day is a game of figuring out who is least likely to kill me
Ein Artikel aus dem Fokus von 22.02 beschäftigt sich mit den möglichen Konsequenzen einer alleinigen Impfpflicht für die Pfleger*innen (einrichtungsbezogene Impfpflicht) auf Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Dabei werden Themen wie der besondere Schutz vulnerabler Gruppen, der Pflege- und Assistenznotstand sowie weitere Probleme von Menschen mit Behinderungen während der Pandemie behandelt. Eine Betroffene: „Impfpflicht für Pfleger zerstört mein Leben…Wer interessiert sich schon für meine Geschichte? Die Politiker? Das glaube ich kaum“ Probleme bei Corona-Impfpflicht
Ein Beitrag von ORF Kärnten vom 2.12.2021, der anlässlich des Tages der Menschen mit Behinderungen die Problemfelder des Jahres 2021 zusammenfasst und dabei auf Isabella Scheiflinger, Anwältin für Menschen mit Behinderung des Landes Kärnten, eingeht – „Die letzten Monate zeigen deutlich, dass bei vielen Menschen einfach auch „die Luft draußen“ ist und die schwierige Zeit Spuren hinterlassen habe, so Scheiflinger.“ – Menschen mit Behinderung in der CoV-Krise
Dieser Artikel vom ZDF vom 30.11.2021 widmet sich den Auswirkungen der Covid -19 Pandemie auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt in Deutschland – „Corona-Pandemie hat Fortschritte zunichte gemacht“ – Menschen mit Behinderung häufiger arbeitslos – und ein kurzer Zeit Artikel vom 08.02. 2022 zum selben Thema: Jobsituation für Behinderte in Pandemie verschlechtert
Ein Beitrag des amerikanischen Think-Tanks Center for American Progress vom 09.02.2022 befasst sich mit dem Thema Arbeitsmarkt, Behinderung und Covid-Pandemie, auch vor dem Hintergrund, dass die Pandemie selbst die Anzahl der Menschen mit Beeinträchtigungen der Arbeitspopulation vergrößern wird.- „Labor market policy must take into account the dramatic increase in the disabled population” – COVID-19 Likely Resulted in 1.2 Million More Disabled People by the End of 2021
Zum Schluss kommt kein Zeitungsartikel, sondern die offizielle Stellungnahme des österreichischen Monitoringausschusses inklusive Handlungsempfehlungen. Die Stellungnahme ist auch in leichter Sprache verfügbar. „Im Rahmen des Versuchs, die Pandemie zu bewältigen, kam es zu zahlreichen Maßnahmen mit teilweise sehr negativen Auswirkungen für Menschen mit Behinderungen.“ Menschen mit Behinderungen während der COVID-19-Pandemie – 2021
Wissenschaftliche Artikel
Dieser bereits etwas ältere Kommentar aus dem Journal Lancet von Tom Shakespeare et al. fasst die Situation für Menschen mit Behinderungen zusammen: „A better future has to grow from learning the lessons, listening to the life experiences of people with disabilities, and making meaningful investments that improve the wellbeing and socioeconomic conditions of people with disabilities” – Triple jeopardy: disabled people and the COVID-19 pandemic
Ein Artikel von Michael Zander aus der Zeitschrift für Disability Studies vom Juli 2021 arbeitet die Auswirkung von Corona auf Menschen mit Behinderungen aus einer Disability Studies Sicht auf. „Dargestellt und diskutiert werden unter anderem Befunde und Positionen zu den sozial-ökologischen Charakteristika der Pandemie, zu erhöhten Erkrankungs- und Sterberisiken in Institutionalisierung der Behindertenhilfe sowie zur Triage und dem Aufkommen sozialdarwinistisch getönter Verschwörungsideologien. Abschließend werden Fragen zur Krisenbewältigung aufgeworfen.“ – Corona-Pandemie und Behinderung – ein Überblick
Eine Studie, veröffentlicht im Disability and Health Journal im Jänner 2022, beschäftigte sich mit der digitalen Kluft in Bezug auf Menschen mit Behinderungen in der Pandemie und vergleicht das Internetverhalten in Korea von Menschen mit und ohne Behinderungen. „We identified significant differences between PWOD and PWD in their Internet usage change during the pandemic – To ensure better post-pandemic outcomes for marginalized groups including PWD, the governments and authority agencies must facilitate digital access and services with appropriate accommodations needed by those populations.” – Effect of digital divide on people with disabilities during the COVID-19 pandemic.
Ein Artikel, veröffentlicht im International Journal of Environmental Research and Public Health vom April 2021, fasst Ergebnisse aus anderen Studien bezüglich der Auswirkung von Lockdown-Maßnahmen auf Menschen mit Behinderungen zusammen und gibt somit eine gute Übersicht über das Thema. „Lack of disability-inclusive response and emergency preparedness and pre-pandemic disparities created structural disadvantages, exacerbated during the pandemic.” – Lockdown-Related Disparities Experienced by People with Disabilities during the First Wave of the COVID-19 Pandemic: Scoping Review with Thematic Analysis – Ein Reviewartikel aus dem Disability and Health Journal vom Jänner 2021 fasst ebenfalls diesbezüglich Literaturbefunde zusammen – Impact of COVID-19 on people with physical disabilities: A rapid review
Die Autor*innen dieser Studie befragten 441 Amerikaner*innen mit Behinderungen mit Instrumenten zur Messung von Angst und Depression und suchte nach Prädikatoren dafür in dieser Population. „In our sample, 61.0% and 50.0% of participants met criteria for a probable diagnosis of major depressive disorder and generalized anxiety disorder, respectively. Participants also experienced significantly higher levels of disability-related stigma and social isolation compared to prepandemic norms” – Predicting depression and anxiety among adults with disabilities during the COVID-19 pandemic
Ein kurzer Bericht, veröffentlicht in den Archives of Physical Medicine and Rehabilitation vom Juli 2021 vergleicht die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitslosigkeit von Amerikaner*innen mit und ohne Behinderungen zwichen Februar und April 2020 „The percentage unemployed rose from 3.0% to 6.5% for persons with disabilities and 2.9% to 10.5% for people without disabilities.“ – Changes in the Employment Status of People With and Without Disabilities in the United States During the COVID-19 Pandemic
Ein weiterer kurzer Bericht veröffentlicht in Disability in Health im Juli 2021. In der Studie wurden 109 gebildete und gut verdienende Amerikaner*innen mit Behinderungen bezüglich der Auswirkung der Pandemie auf ihr Leben befragt. „Only 14.9% of survey respondents reported disruptions in employment. On average, 54.0% of service changes were due to discontinuation, including loss of physical therapy, job coaching, community organizations, transportation, and peer supports.” – Impact of COVID-19 on services for people with disabilities and chronic health condition