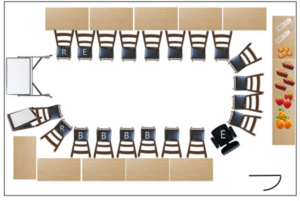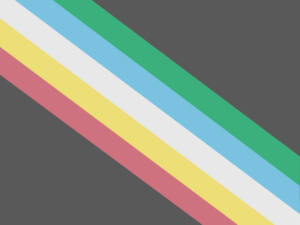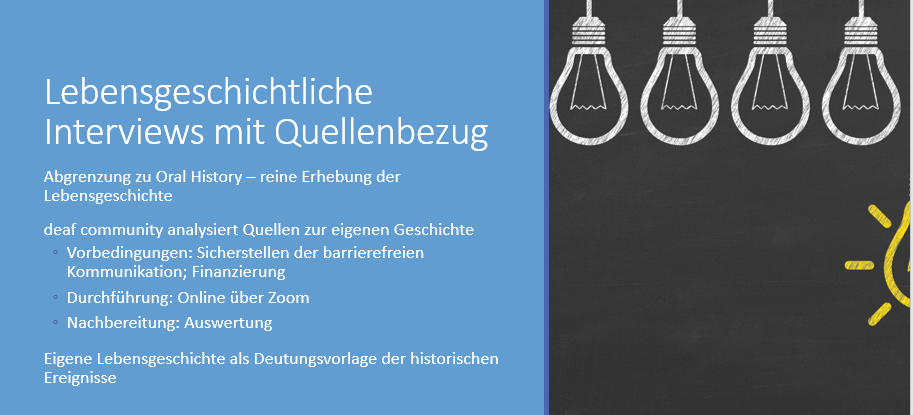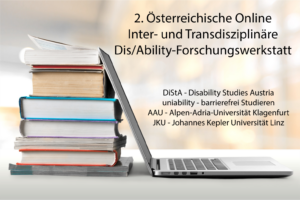Nikolaus Hauer und Helga Fasching, Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Wien, präsentierten das in dem Beitrag dargestellte Projekt bei der 2. DiStA Forschungswerkstatt 2023.
Ansätze partizipativer Forschung in universitärer Lehre
Unter dem Titel „Inklusion in Arbeit – zur Bedeutung von Assistenzmaßnahmen“ wurde im Wintersemester 22/23 am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien der Versuch unternommen, gemeinsam mit Expert-innen mit Behinderungserfahrung universitäre Lehre partizipativ zu gestalten. Die Lehrveranstaltung wurde gemeinsam mit drei Expert-innen des Projekts P.I.L.O.T. (Integration Wien)[1] geplant, durchgeführt und reflektiert. Im Anschluss an die Prinzipien partizipativer Forschung verstehen wir die partizipative Gestaltung universitärer Lehre als den aktiven Einbezug von Menschen mit Behinderungserfahrungen als Expert-innen in eigener Sache. Das meint auch den Versuch, Diskursräume zu eröffnen, welche Menschen mit Behinderungserfahrung oftmals strukturell schwer zugänglich gemacht werden.
Hauser, Kremsner, Schuppener, Koenig und Buchner (2016) halten fest, dass Ansätze partizipativer und inklusiver Forschung vereinzelt Einzug in universitäre Lehre finden. Nichtsdestotrotz sei zu festzustellen, dass diese zu kurz greifen würden, „um von einer ‚echten‘ und institutionell verankerten Partizipation“ (ebd., S. 287) sprechen zu können. So lässt sich auch die Universität als Sozialraum betrachten, der in seiner inhärenten Struktur exkludierende Bedingungen für Menschen mit Behinderung schafft. Im Sinne eines kritischen und teilhabeorientieren Verständnisses von Wissenschaft gilt es also auch, Bedingungen, welche Behinderungserfahrungen strukturell hervorbringen, in den Blick zu rücken. Es lässt sich also festhalten, dass die Lehrveranstaltung auch einen Versuch darstellt, in Form partizipativer Gestaltung eben jene Perspektiven von Menschen mit Behinderungserfahrung auf behindernde Strukturen aktiv miteinzubeziehen und im Sinne einer partialen Perspektive (Haraway 1996) unterschiedliche verortete Sichtweisen zu kollektiver Erkenntnis zu verknüpfen.
Planung und Durchführung der Lehrveranstaltung
Bei einem ersten gemeinsamen Kennenlern- und Planungstreffen mit den Expert-innen wurde die inhaltliche Ausrichtung der Lehrveranstaltung erarbeitet. Die bisherigen Planungsschritte wurden vorgestellt, wie auch erste Ideen zu möglichen Themengebieten, die im Seminar zur Diskussion gebracht werden könnten. Erste Vorschläge waren die Themen Arbeit, Assistenz und Selbstbestimmung. In Absprache und Diskussion mit den Expert-innen wurden diese Themen teilweise angepasst. Arbeit und Assistenz wurden beibehalten. Nach kritischem Einwand der Expert-innen, dass Selbstbestimmung als Begriff zu vieldeutig und thematisch zu umfassend ist, erfolgte eine Einigung auf den Themenbereich von Selbstvertretung. Als vierten Themenbereich wurde auf Vorschlag der Expert-innen Barrierefreiheit ergänzt.
Die partizipative Durchführung der Lehrveranstaltung erfolgte verteilt auf zwei Einheiten in Orientierung an dem Gruppendiskussionsverfahren des Reflecting Team nach Tom Andersen (2011). Dieses Verfahren wurde bereits im FWF-Projekt „Kooperation für Inklusion in Bildungsübergängen“[2] für die Durchführung in partizipativen Forschungskontexten adaptiert (Fasching/Felbermayr/Todd 2023) und im Rahmen der Lehrveranstaltung weiter an den entsprechenden Rahmen angepasst. Der Ablauf erfolgt grundlegend in vier Schritten. Nach dem ersten, eröffnenden Teil sprechen im zweiten Teil die Diskussionsteilnehmer-innen und die Moderator-in über ein bestimmtes Thema und die reflektierenden Beobachter-innen beobachten das Geschehen. Im dritten Teil nehmen die Beobachter-innen eine aktive Rolle ein und teilen der Diskussionsgruppe ihre Beobachtungen mit. Im vierten Teil erfolgt ein erneuter Rollenwechsel, die Diskussionsteilnehmer-innen reflektieren und diskutieren die Darstellungen der Beobachter-innen (vgl. Felbermayr/ Fasching/ Engler 2021, S. 198f.). Diese abschließende Phase bezeichnet die „Reflexion über die Reflexion“ (Fasching/ Felbermayr 2019, S. 447). Zentrale Aspekte dieses Verfahrens bilden dabei die Vergabe unterschiedlicher Diskutant-innen- und Beobachter-innenrollen, wie auch eine Trennung von Diskussions- und Reflexionsphasen.
Dieses Verfahren wurde für die Durchführung der partizipativ gestalteten Einheiten im Seminar übernommen und dem Kontext entsprechend angepasst. Erweitert wurde das Verfahren durch Inputs der Studierendengruppe, welche als Diskussionseinstiege mit den Expert-innen zu den unterschiedlichen Themenblöcken dienen. Von den Studierenden wurden dafür Kurzpräsentationen vorbereitet, die in einfacher Sprache vorgetragen und mit möglichst barrierefrei gestalteten Postern ergänzt wurden. Nach jedem Kurzinput erfolgte eine Diskussion in der Gruppe, welche von einer Studierendengruppe moderiert wurde. Die Seminarleiter-innen nehmen dabei die Rollen der reflektierenden Beobachter-innen ein. Nach Abschluss der Gruppendiskussion werden die Eindrücke und Reflexionen der Beobachter-innen der Gruppe mitgeteilt, in der abschließenden Phase von den Diskussionsteilnehmer-innen ergänzt, kommentiert oder erwidert.
Die zweite partizipative Diskussionseinheit wurde nach ähnlichem methodischem Vorgehen durchgeführt. Ein zentraler Unterscheid war jedoch die thematische Schwerpunktsetzung. Diese wurde nach Abschluss der ersten Einheit festgelegt, wobei den Expert-innen die Auswahl der Themen übergeben wurde. Die gewählten Themen der zweiten Einheit waren Journalismus, Literatur und Sport für Menschen mit Behinderung. Die Expert-innen präsentierten in der zweiten Einheit zu diesen Themen, zu denen anschließend diskutiert wurde.
Ausblick
Aus unserer Perspektive stellt die Durchführung dieser partizipativen Lehrveranstaltung einen Erfolg und eine Bereicherung in der universitären Lehre dar. Es ergeben sich Lernmöglichkeiten auf allen Seiten, also für Expert-innen, Studierende und Lehrende. Auf Basis der Rückmeldungen der Expert-innen im Rahmen der Nachbesprechung lässt sich auch festhalten, dass eine Sensibilisierung auf einer kommunikativen Ebene als wichtig zu erachten ist. Ein Kritikpunkt der Expert-innen war, dass oftmals trotz Bemühen die sprachlichen Formulierungen nicht einfach verständlich waren. Aktuell ist in Zusammenarbeit mit den Expert-innen ein Beitrag in Arbeit, in welchem ihre Perspektiven und Eindrücke noch stärker einfließen sollen, als es an dieser Stelle möglich ist.
Literatur
Andersen, T. (2011). Das Reflektierende Team. Dialoge und Dialoge über die Dialoge. Dortmund: verlag modernes lernen. 5. Auflage
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) (2016). UN – Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung – Neue deutsche Übersetzung. Wien. Online: https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=19 , letzter Zugriff: 06.07.2023
Fasching, H.; Felbermayr, K. (2019). „Please treat me respectful“. Partizipative Forschung mit Jugendlichen mit Behinderung zu ihren Kooperationserfahrungen im Übergang von der Schule in (Aus-) Bildung und Beschäftigung. Zeitschrift für Heilpädagogik. 70. S. 442-453.
Fasching, H.; Felbermayr, K.; Todd, L. (2023). Involving Young People with Disabilities in Post-school Transitions through Reflecting Teams. Methodological Reflections and Adaptations for More Participation in a Longitudinal Study. International Journal of Educational and Life Transitions, 2(1): 19, S. 1–15. DOI: https://doi.org/10.5334/ijelt.44
Felbermayr, K.; Fasching, H.; Engler, S. (2021). Qualitativ, partizipativ und reflexiv. Partizipative Kooperation am inklusiven Bildungsübergang erforschen. In: Engel, J.; Epp, A., Lipkina, J., Schinkel, S., Terhart, H. & Wischmann, A. (Hrsg.), Bildung im gesellschaftlichen Wandel. Qualitative Forschungszugänge und Methodenkritik. DGfE: Budrich, S. 193-209
Haraway, D. (1996). Situiertes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das Privileg einer partialen Perspektive. In: Scheich, E. (Hrsg.): Vermittelte Weiblichkeit. Feministische Wissenschafts- und Gesellschaftstheorie. Hamburg, S. 217-248
Hauser, M.; Kremsner, G.; Schuppener, S.; Koenig., O.; Buchner, T. (2016). Auf dem Weg zu einer Inklusiven Hochschule? Entwicklungen in Großbritannien, Irland, Deutschland und Österreich. In: Buchner, T.; Koenig,O.; Schuppener, S. (Hrsg.). Inklusive Forschung. Gemeinsam mit Menschen mit Lernschwierigkeiten forschen. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt S. 278-298
[1] https://www.integrationwien.at/de/arbeit-beschaeftigung-de/projekt-pilot-de
[2] Projektnummer P-29291, Webseite: https://kooperation-fuer-inklusion.univie.ac.at/