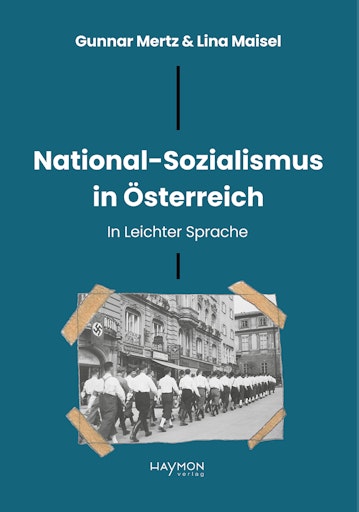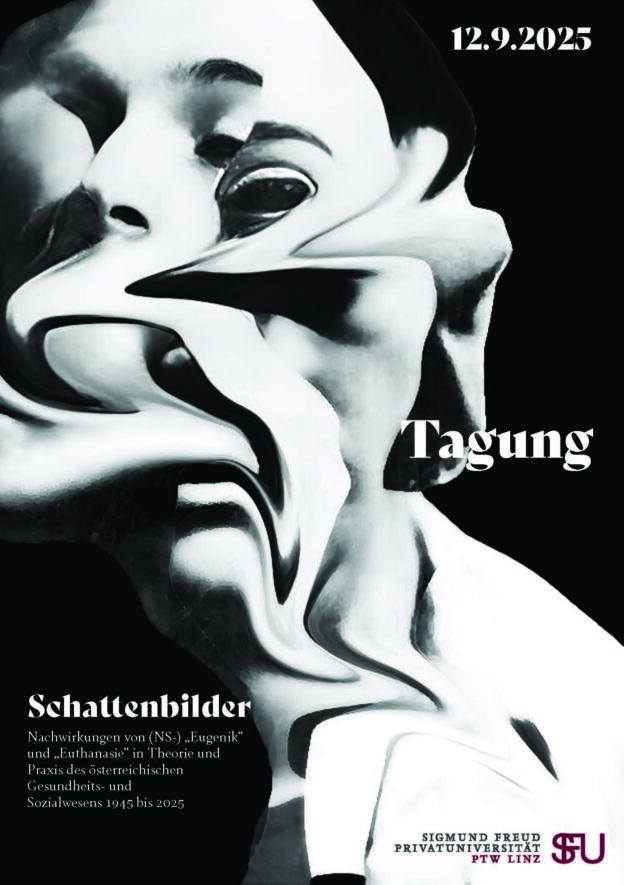Unter diesem Titel diskutierte Nicole Brown (University College London) Strukturen und Kulturen, die die akademische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und neurodivergenten Personen erschweren. Die Veranstaltung fand am 4. November 2025 statt und wurde von der Abteilung Gleichstellung, Chancengerechtigkeit und Vielfalt sowie dem Betriebsrat für das wissenschaftliche Universitätspersonal an der Johannes Kepler Universität Linz organisiert.
Unsichtbarkeit und strukturelle Ausschlüsse
In ihrer Einleitung zum Thema benannte die Moderatorin Angela Wegscheider einen zentralen Widerspruch: Würde sich der Anteil von Menschen mit Behinderungen in der österreichischen Bevölkerung (etwa 15 %) auch in der Universitätsstatistik widerspiegeln, müssten an der JKU rund 3.500 Studierende und 450 wissenschaftlich Beschäftigte mit Behinderungen erfasst sein. Die tatsächlichen Zahlen liegen jedoch deutlich darunter, was auf fortbestehende Barrieren im Bildungs- und Wissenschaftssystem hindeutet.
Nicole Brown verdeutlichte in ihrem Vortrag, dass Ableismus – also die gesellschaftliche und institutionelle Bevorzugung nichtbehinderter Normen – an Hochschulen tief verankert ist. Strukturelle Unsichtbarmachung, mangelnde Sensibilität bei Universitätsangehörigen und institutionelle Praktiken führen dazu, dass viele behinderte oder chronisch kranke Personen ihre Beeinträchtigung nicht offenlegen. „Disclosure“, so Brown, sei meist ein komplexer Aushandlungsprozess zwischen Risiko und Notwendigkeit, eine „Cost-Benefit-Analyse“ im Spannungsfeld von Stigma und Selbstschutz.
Forschungsperspektive: Embodied Inquiry
Methodisch präsentierte Brown ihren Ansatz der „Embodied Inquiry”, bei dem körperliche und sinnliche Erfahrungen als zentrale Wissensquelle betrachtet werden. Dadurch wird Forschung zu einem relationalen, verkörperten Prozess, der über sprachliche Repräsentationen hinausgeht. Mithilfe kreativer und visueller Methoden, wie der Gestaltung von „Identity Boxes” oder bildhaften Darstellungen akademischer Räume, versucht Brown, individuelle Erfahrungswelten sichtbar zu machen und institutionelle Strukturen erfahrbar zu kritisieren.
Dieser Forschungszugang ist auch theoretisch in der Phänomenologie und Hermeneutik verankert und knüpft an gegenwärtige Diskussionen in den Disability Studies über affektive, leibliche und epistemische Dimensionen von Behinderung an.
Wege zu inklusiver Praxis
Am Ende gab Brown noch praktische Empfehlungen. Auf persönlicher Ebene plädierte sie für ein Klima der Offenheit, gegenseitiger Unterstützung und Solidarität. Auf institutioneller Ebene forderte sie, Prekarität und befristete Verträge abzubauen, flexible Arbeitsmodelle auszubauen und universitäre Richtlinien im Hinblick auf Diskriminierungsrisiken und Ableismus systematisch zu überprüfen. Förderinstitutionen sollten, so Brown, inklusive Kriterien entwickeln, die unterschiedliche Lebensrealitäten anerkennen und strukturelle Ungleichheiten nicht reproduzieren.
„Nothing about us without us“
Den Abschluss bildete der Aufruf, Behinderung nicht länger als Randthema, sondern als zentralen Bestandteil wissenschaftlicher Kultur zu verstehen. Die Weiterentwicklung der Universität in Richtung mehr Inklusion, auch in der Lehre, und Forschung dazu muss mit dem Prinzip „Nothing about us without us“ verbunden sein. Dazu müsse die Universität attraktiv für mehr Menschen mit Behinderungen sein.
Die lebhafte Diskussion im Anschluss zeigte das große Interesse an der Frage, wie sich diese Ansätze in den universitären Alltag und die Forschungspraxis übersetzen lassen.
In ihrem Vortrag verdeutlichte Brown, dass Inklusion nicht allein eine Frage der Barrierefreiheit ist, sondern eine grundlegende kulturelle Veränderung in Haltung und Wahrnehmung erfordert. Weitgehende Barrierefreiheit ist eine Notwendigkeit, Vielfalt eine Ressource.